Durch Sinnbildung zur Sicherheit: Ob Datenschutz, Phishing oder Mobile Sicherheit, bei uns wird aus Ihrem Sicherheitsbedürfnis gelebter Informationsschutz. Lernen Sie jetzt Ihre Möglichkeiten kennen, für mehr Sicherheit in Ihrer Organisation zu sorgen.

Weiterlesen„Uns gefällt, dass sich SECUTAIN intensiv mit unseren Anforderungen beschäftigt und unsere individuellen Wünsche umsetzt. Zudem mögen wir, dass dieses technische Thema sehr unterhaltsam, verständlich und umsetzungsnah kommuniziert wird. Wir freuen uns über positives Feedback zur Kampagne aus unserem Haus.“
Manja Bruns
Managerin der Awareness-Kampagne bei Hermes

Weiterlesen„Lernen mit Videos ist ein aktuelles Thema, das viele aus dem privaten Bereich bereits kennen. Uns gefiel an dem Ansatz von SECUTAIN, dass das Thema Datenschutz, das gerne als sperrig wahrgenommen wird, unterhaltsam und verständlich aufbereitet wurde. Das hilft uns, das wichtige Thema Datenschutz präsent zu halten.“
Matthias Lanzrath
Leiter der Informationstechnologie, DER Touristik Partner Service GmbH & Co. KG

Weiterlesen„Das Awareness-Paket von SECUTAIN ermöglicht es uns, unsere IT als Hauptaufgabe wahrzunehmen und das Thema Informationssicherheit dennoch im Auge zu behalten und voranzutreiben. Die professionelle Betreuung durch den SECUTAIN Awareness-Manager und eine spürbare Veränderung im Verhalten unserer Mitarbeiter:innen in Fragen zur Informationssicherheit, haben uns dazu bewogen, auch im zweiten Jahr die Zusammenarbeit mit SECUTAIN fortzuführen.“
Dieter Rigbi und Lukas Hauser
Verantwortlich für IT und Informationssicherheit

Weiterlesen„Natürlich findet die Ankündigung eines verpflichtenden E‑Learnings anfangs nicht immer nur Freunde. Die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Haus aufgrund der unterhaltsamen und verständlichen Aufbereitung der Inhalte von SECUTAIN haben uns jedoch positiv überrascht. Das hilft auch der Imagebildung für den gesamten Bereich Informationssicherheit.“
Benjamin Lenz
verantwortlich für Awarenessbildung für Informationssicherheit bei der Berlin Hyp

Weiterlesen„Obwohl das Thema aus der Unternehmensstrategie von REGIOCAST hergeleitet wurde, sind wir in der Erarbeitung des Kampagnenkonzepts doch sehr schnell zu konkreten Empfehlungen gekommen. Das frühe Einbinden der Stakeholder unserer Organisation war wichtig, da so von Anfang an die einzelnen Sichtweisen auf das Thema Berücksichtigung fanden.“
Enno Santjer
Leiter Broadcast & IT
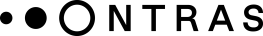
Weiterlesen„Wir konnten mit der Kampagne dem Thema Informationssicherheit zu mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit verhelfen. Durch die Auswahl und Gestaltung der Maßnahmen haben wir es darüber hinaus geschafft, dem Thema Sympathie und Interesse zu verleihen und damit nachhaltig die Einstellung der Belegschaft zu dem Thema zu verändern.“
Dr. Mario Lochmann
Head of IT Management bei ONTRAS

Weiterlesen„Die unterhaltsame und leicht verständliche Aufbereitung der Themen hat uns überzeugt. Hinzu kam, dass unsere hohen Ansprüche an Datenschutz und Anonymität in der Lernplattform vollständig abgebildet und umgesetzt worden sind.“
Michael Markefsky
Informationssicherheitsbeauftragter des Konzerns neu.sw

Weiterlesen„Wir haben sehr zu schätzen gewusst, dass der Ansatz von SECUTAIN neben dem fachlichen Know How ganz stark den Fokus auf das Thema ‚Wie kommuniziere ich eigentlich Informationssicherheit nachhaltig‘ lenkte. Die Rücksichtnahme auf Unternehmenskultur und Ansprache, um eine Kampagne erfolgreich zu gestalten, hat uns überzeugt.“
Markus Grube
Leiter Unternehmenssteuerung und IT der WBM

Weiterlesen„Die leicht verständliche und unterhaltsame Aufbereitung der Inhalte von SECUTAIN hat uns nicht nur überzeugt, sondern auch überrascht. Die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Hause zeigen, dass die Online-Kurse gut angenommen und das Thema Informationssicherheit nun noch besser verstanden und gelebt wird.“
Ejder Durak
Datenschutzbeauftragter bei der GiS

Weiterlesen„Eine schöne Herausforderung: Datenklassifizierung ist kein Thema, das permanent Begeisterung entgegengebracht wird. Ganz klar. Aber solch ein Thema in drei Minuten so aufzubereiten, dass Verständnis und Motivation geschaffen wird, war eine spannende Aufgabe für uns.“
David Scribane
Leiter SECUTAIN

Weiterlesen„Wir haben viele Kurse getestet und es gab keinen Anbieter, dessen Kurse uns auch nur halb so gut gefallen haben wie die von SECUTAIN. SECUTAIN war für uns der perfekte Start ins E-Learning.
Sabine Knobloch und Mario Reuter
Unsere Mitarbeitenden sind durch die Bank und generationsübergreifend begeistert von den SECUTAIN E-Learnings. Die Kurse sind verständlich, hilfreich, toll animiert und sehr unterhaltsam. Zu anderen Themen bieten wir auch eigene Kurse an – aber die E-Learnings von SECUTAIN, die bringen echt Leben in unser LMS.“
Leiterin der Rechtabteilung bei Streifeneder und Geschäftsführerin einer Streifeneder Tochterfirma und Leiter Vertragsmanagement bei Streifeneder

Weiterlesen„Das von SECUTAIN geschnürte Paket hat uns als IT-Abteilung sehr dabei geholfen, den Mitarbeitenden der Gölzner GmbH bewusst zu machen, wie hoch die Bedrohungslage für uns ist. In den individuell konzipierten Maßnahmen haben unsere Mitarbeitenden gelernt, wie sie mit Cyberrisiken umgehen können, um das Unternehmen nicht in Gefahr zu bringen. Wir werden auch weiterhin Maßnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit durchführen.“
Heiko Thöler
verantwortlich für IT bei der Gölzner GmbH

Weiterlesen„Uns gefällt, dass sich SECUTAIN intensiv mit unseren Anforderungen beschäftigt und unsere individuellen Wünsche umsetzt. Zudem mögen wir, dass dieses technische Thema sehr unterhaltsam, verständlich und umsetzungsnah kommuniziert wird. Wir freuen uns über positives Feedback zur Kampagne aus unserem Haus.“
Manja Bruns
Managerin der Awareness-Kampagne bei Hermes

Weiterlesen„Lernen mit Videos ist ein aktuelles Thema, das viele aus dem privaten Bereich bereits kennen. Uns gefiel an dem Ansatz von SECUTAIN, dass das Thema Datenschutz, das gerne als sperrig wahrgenommen wird, unterhaltsam und verständlich aufbereitet wurde. Das hilft uns, das wichtige Thema Datenschutz präsent zu halten.“
Matthias Lanzrath
Leiter der Informationstechnologie, DER Touristik Partner Service GmbH & Co. KG

Weiterlesen„Das Awareness-Paket von SECUTAIN ermöglicht es uns, unsere IT als Hauptaufgabe wahrzunehmen und das Thema Informationssicherheit dennoch im Auge zu behalten und voranzutreiben. Die professionelle Betreuung durch den SECUTAIN Awareness-Manager und eine spürbare Veränderung im Verhalten unserer Mitarbeiter:innen in Fragen zur Informationssicherheit, haben uns dazu bewogen, auch im zweiten Jahr die Zusammenarbeit mit SECUTAIN fortzuführen.“
Dieter Rigbi und Lukas Hauser
Verantwortlich für IT und Informationssicherheit

Weiterlesen„Natürlich findet die Ankündigung eines verpflichtenden E‑Learnings anfangs nicht immer nur Freunde. Die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Haus aufgrund der unterhaltsamen und verständlichen Aufbereitung der Inhalte von SECUTAIN haben uns jedoch positiv überrascht. Das hilft auch der Imagebildung für den gesamten Bereich Informationssicherheit.“
Benjamin Lenz
verantwortlich für Awarenessbildung für Informationssicherheit bei der Berlin Hyp

Weiterlesen„Obwohl das Thema aus der Unternehmensstrategie von REGIOCAST hergeleitet wurde, sind wir in der Erarbeitung des Kampagnenkonzepts doch sehr schnell zu konkreten Empfehlungen gekommen. Das frühe Einbinden der Stakeholder unserer Organisation war wichtig, da so von Anfang an die einzelnen Sichtweisen auf das Thema Berücksichtigung fanden.“
Enno Santjer
Leiter Broadcast & IT
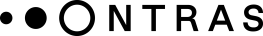
Weiterlesen„Wir konnten mit der Kampagne dem Thema Informationssicherheit zu mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit verhelfen. Durch die Auswahl und Gestaltung der Maßnahmen haben wir es darüber hinaus geschafft, dem Thema Sympathie und Interesse zu verleihen und damit nachhaltig die Einstellung der Belegschaft zu dem Thema zu verändern.“
Dr. Mario Lochmann
Head of IT Management bei ONTRAS

Weiterlesen„Die unterhaltsame und leicht verständliche Aufbereitung der Themen hat uns überzeugt. Hinzu kam, dass unsere hohen Ansprüche an Datenschutz und Anonymität in der Lernplattform vollständig abgebildet und umgesetzt worden sind.“
Michael Markefsky
Informationssicherheitsbeauftragter des Konzerns neu.sw

Weiterlesen„Wir haben sehr zu schätzen gewusst, dass der Ansatz von SECUTAIN neben dem fachlichen Know How ganz stark den Fokus auf das Thema ‚Wie kommuniziere ich eigentlich Informationssicherheit nachhaltig‘ lenkte. Die Rücksichtnahme auf Unternehmenskultur und Ansprache, um eine Kampagne erfolgreich zu gestalten, hat uns überzeugt.“
Markus Grube
Leiter Unternehmenssteuerung und IT der WBM

Weiterlesen„Die leicht verständliche und unterhaltsame Aufbereitung der Inhalte von SECUTAIN hat uns nicht nur überzeugt, sondern auch überrascht. Die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Hause zeigen, dass die Online-Kurse gut angenommen und das Thema Informationssicherheit nun noch besser verstanden und gelebt wird.“
Ejder Durak
Datenschutzbeauftragter bei der GiS

Weiterlesen„Eine schöne Herausforderung: Datenklassifizierung ist kein Thema, das permanent Begeisterung entgegengebracht wird. Ganz klar. Aber solch ein Thema in drei Minuten so aufzubereiten, dass Verständnis und Motivation geschaffen wird, war eine spannende Aufgabe für uns.“
David Scribane
Leiter SECUTAIN

Weiterlesen„Wir haben viele Kurse getestet und es gab keinen Anbieter, dessen Kurse uns auch nur halb so gut gefallen haben wie die von SECUTAIN. SECUTAIN war für uns der perfekte Start ins E-Learning.
Sabine Knobloch und Mario Reuter
Unsere Mitarbeitenden sind durch die Bank und generationsübergreifend begeistert von den SECUTAIN E-Learnings. Die Kurse sind verständlich, hilfreich, toll animiert und sehr unterhaltsam. Zu anderen Themen bieten wir auch eigene Kurse an – aber die E-Learnings von SECUTAIN, die bringen echt Leben in unser LMS.“
Leiterin der Rechtabteilung bei Streifeneder und Geschäftsführerin einer Streifeneder Tochterfirma und Leiter Vertragsmanagement bei Streifeneder

Weiterlesen„Das von SECUTAIN geschnürte Paket hat uns als IT-Abteilung sehr dabei geholfen, den Mitarbeitenden der Gölzner GmbH bewusst zu machen, wie hoch die Bedrohungslage für uns ist. In den individuell konzipierten Maßnahmen haben unsere Mitarbeitenden gelernt, wie sie mit Cyberrisiken umgehen können, um das Unternehmen nicht in Gefahr zu bringen. Wir werden auch weiterhin Maßnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit durchführen.“
Heiko Thöler
verantwortlich für IT bei der Gölzner GmbH

Weiterlesen„Uns gefällt, dass sich SECUTAIN intensiv mit unseren Anforderungen beschäftigt und unsere individuellen Wünsche umsetzt. Zudem mögen wir, dass dieses technische Thema sehr unterhaltsam, verständlich und umsetzungsnah kommuniziert wird. Wir freuen uns über positives Feedback zur Kampagne aus unserem Haus.“
Manja Bruns
Managerin der Awareness-Kampagne bei Hermes




